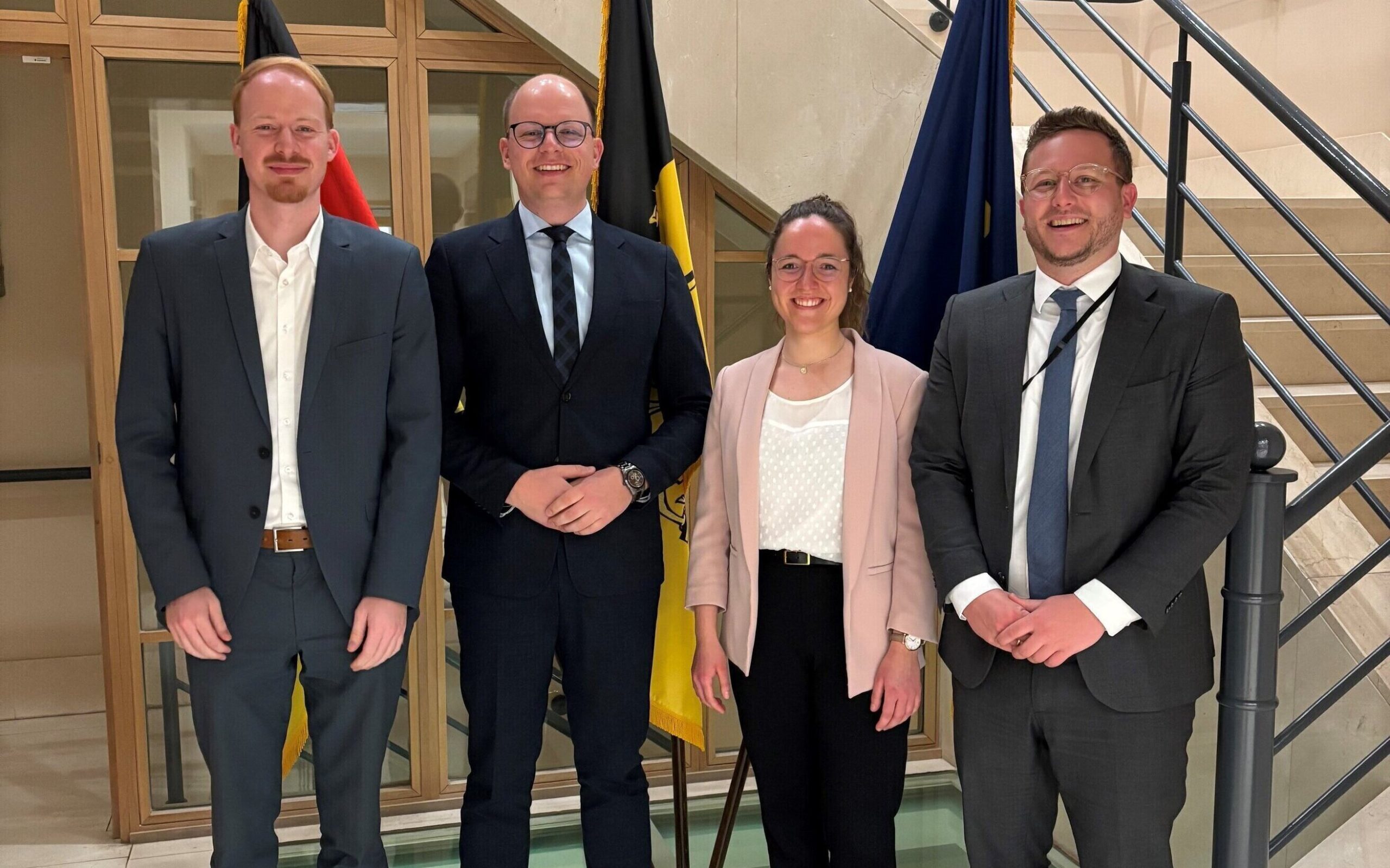Kommunen zu Reformen im EU-Vergaberecht positioniert
Brüssel. Die EU-Kommission plant, das europäische Vergaberecht bis zum Sommer 2026 umfassend zu reformieren, was erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Auftragsvergabe in Städten, Gemeinden und Landkreisen haben wird. In diesem Zusammenhang haben die Kommunalen Landesverbände Baden-Württembergs sowie ihr gemeinsames Europabüro den Dialog mit Vertretern der EU-Kommission und des Europäischen Parlaments gesucht. Ziel dieser Gespräche war es, Vorschläge zu erarbeiten, die eine reformierte Vergabepraxis sowohl kommunalfreundlich als auch praxistauglich gestaltet.
Anhebung der EU-Schwellenwerte
In einem aktuellen Positionspapier fordern die Kommunalvertreter die EU-Kommission auf, die Schwellenwerte für öffentliche Vergaben deutlich zu erhöhen. Ein zentraler Grund für diese Forderung ist die inflationsbedingte Anpassung der Schwellenwerte, aber auch die Erkenntnis, dass laut Untersuchungen der EU-Kommission bei grenzüberschreitenden Vergaben lediglich knapp drei Prozent aller Angebote von internationalen Bietern stammen. Dies deutet darauf hin, dass der grenzüberschreitende Vergabemarkt in der Praxis weiterhin nicht etabliert ist, da die Vergabeverfahren häufig regional geprägt sind.
Konkrete Vorschläge beinhalten eine Erhöhung des Schwellenwerts für Liefer- und Dienstleistungen von derzeit 221.000 Euro auf mindestens 750.000 Euro. Hinzu kommt der Wunsch, für die Vergabe von Planungsleistungen einen gesonderten Schwellenwert von ebenfalls mindestens 750.000 Euro zu etablieren. Solche Anpassungen würden es Kommunen erleichtern, größere Aufträge zu vergeben und gleichzeitig lokale Anbieter zu fördern.
Darüber hinaus sprechen sich die Kommunalen Landesverbände gegen die Einführung von verpflichtenden Vergabekriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Sie argumentieren, dass der kommunale Entscheidungsspielraum durch solche Vorgaben unnötig eingeschränkt wird. Den einzelnen Kommunen solle überlassen bleiben, ob und in welchem Maße sie ESG-Kriterien in ihren Vergabeverfahren anwenden möchten.
Als alternative Lösung schlagen die Verbände vor, die Stärkung und Nutzung von ESG-Labeln durch die EU-Kommission zu fördern. Diese Labels sollten möglichst kostengünstig und unkompliziert für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zugänglich sein. Ein solcher Schritt könnte dazu beitragen, die Auswahl von Vertragspartnern zu vereinfachen und es den Bietern zu ermöglichen, ihre Eignung durch spezifische Zertifikate nachzuweisen.
Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit
Ein weiteres Anliegen der Kommunalvertreter ist die Stärkung der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit zwischen Kommunen. Sie fordern, dass das EU-Vergaberecht diese Form der Kooperation nicht behindert. Bisherige rechtliche Rahmenbedingungen, die auf dem sogenannten „kooperativen Konzept“ basieren, sowie verschiedene Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) haben eine Rechtsunsicherheit geschaffen, die die interkommunale Zusammenarbeit erschwert. Aus diesem Grund wird angeregt, diese Zusammenarbeit von der Anwendbarkeit des Vergaberechts auszunehmen, um den Kommunen mehr Handlungsspielraum zu bieten.
Zukunftsperspektiven der Reform
Die angestrebte Reform des europäischen Vergaberechts erhebt nicht nur den Anspruch, die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern, sondern auch die Rahmenbedingungen für die öffentliche Auftragsvergabe an die aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Kommunalen Landesverbände setzen auf einen offenen Dialog mit der EU-Kommission, um eine praxisnahe Umsetzung der Vorschläge zu gewährleisten, die sowohl den Bedürfnissen der Kommunen als auch den Anforderungen an Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit gerecht wird. Neben der Anpassung der Schwellenwerte und der Berücksichtigung von ESG-Kriterien geht es auch um die Schaffung eines rechtssicheren Rahmens für die interkommunale Zusammenarbeit, die heute mehr denn je von Bedeutung ist. Die Entwicklung eines solchen Rahmens könnte dazu beitragen, dass Kommunen effizienter zusammenarbeiten und somit innovative Lösungen für lokale Herausforderungen fördern können.
Fazit: Zunehmender Handlungsbedarf
Die geplante Reform des europäischen Vergaberechts stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die öffentliche Auftragsvergabe zu modernisieren. Die Forderungen nach der Anhebung der EU-Schwellenwerte und der Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit verdeutlichen den Handlungsbedarf, der für eine zukunftsfähige und praxisnahe Vergabepraxis erforderlich ist. Nur durch den Dialog zwischen den Kommunen und der EU können die richtigen Lösungen gefunden werden, um den Herausforderungen im Vergaberecht effektiv zu begegnen.